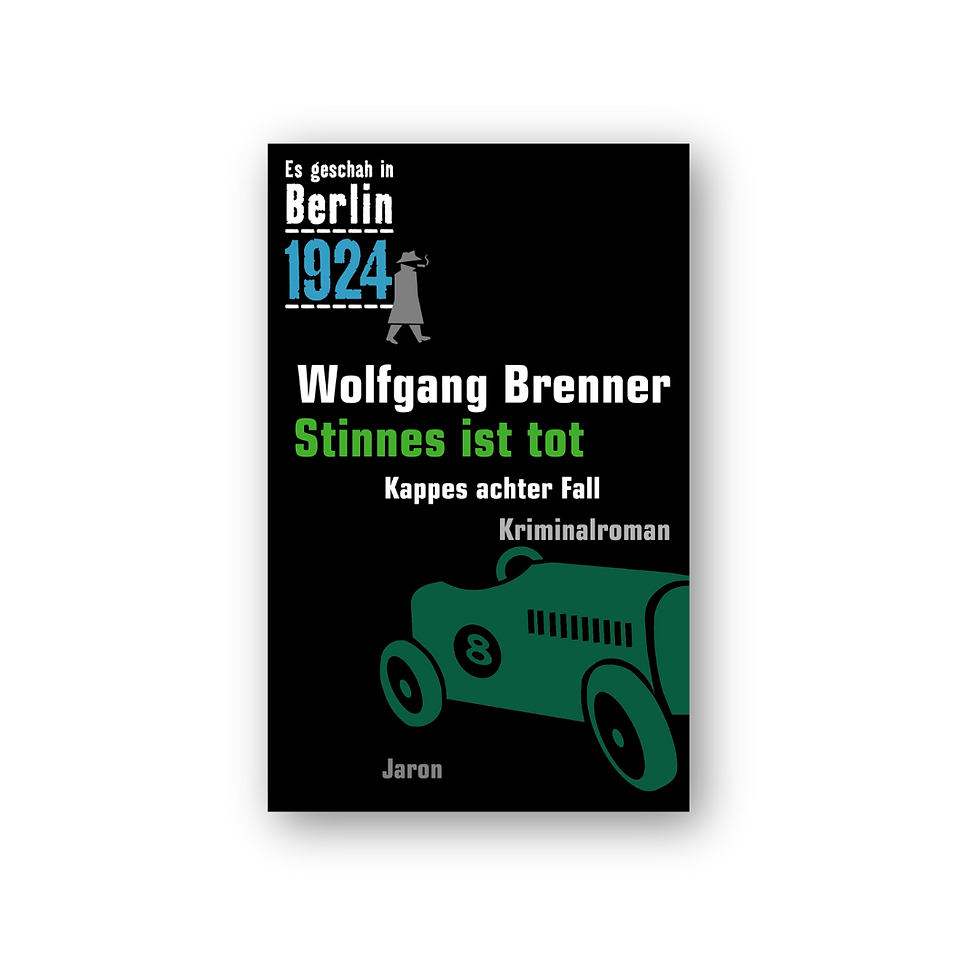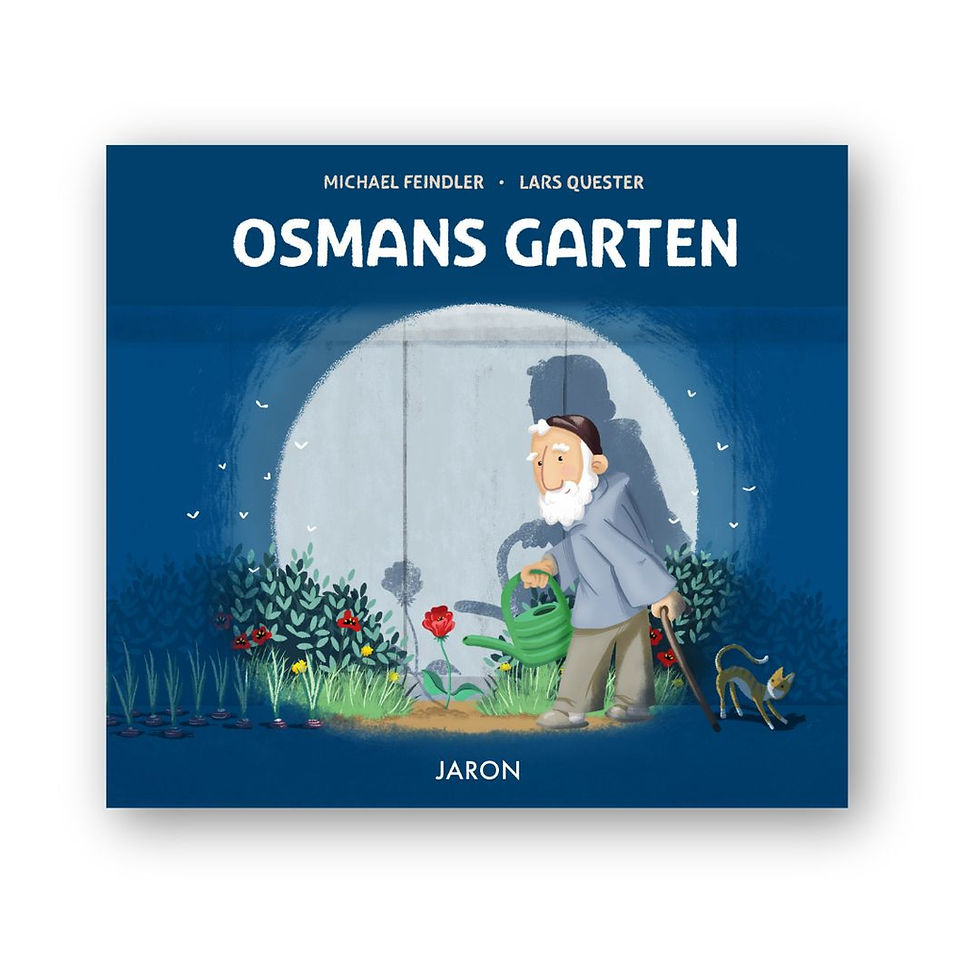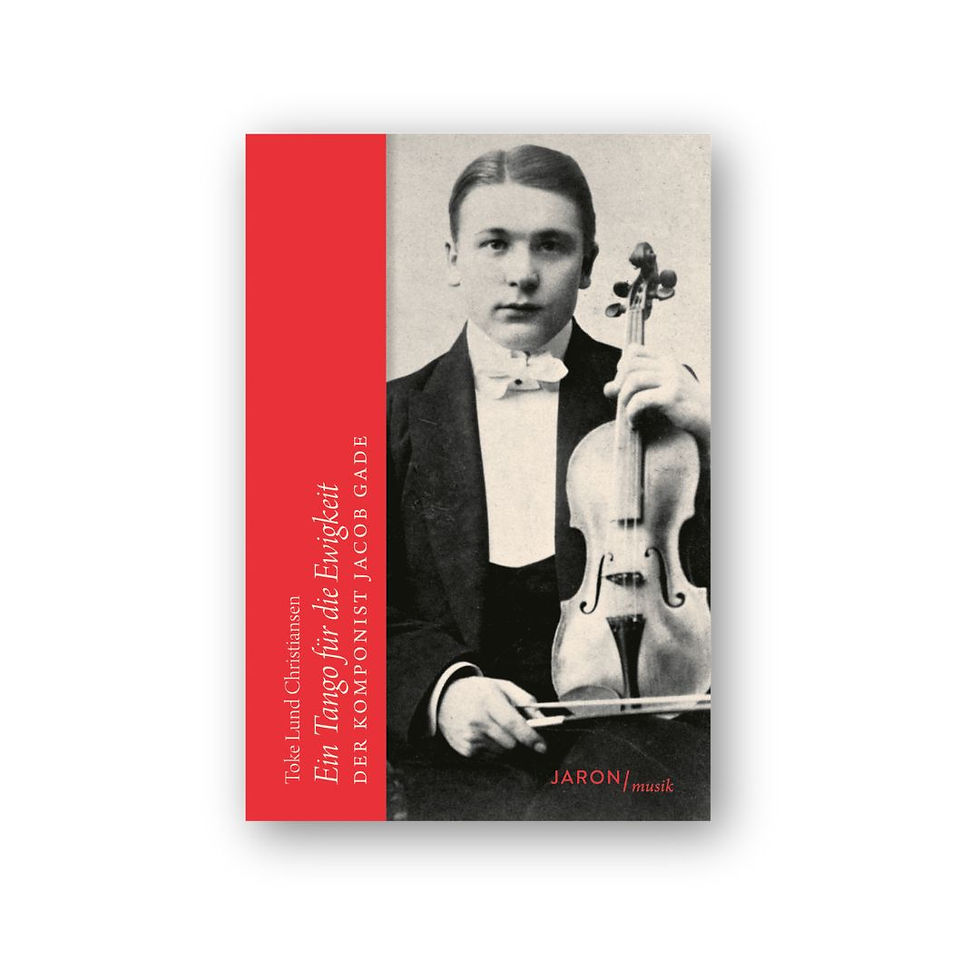Schon mit fünf Jahren weiß Hanna, dass Verstecken nicht nur ein Spiel ist. Wenn im Berliner Umland die Tiefflieger kommen, kann es überlebenswichtig sein. Doch nicht nur vor den Bomben, auch vor dem Macht- und Kontrollanspruch der Mutter versteckt sich Hanna: „Verstockt ist sie. Man muss ihn brechen, ihren Willen zur Eigenmächtigkeit.“
Hanna erzählt von ihren Fluchtorten wie den Märchen oder der Schaukel, von ihrer ersten Lehrerin, die ihre künstlerische Begabung entdeckt und fördert, von der Solidarität unter den Kindern auf dem Hof. Im Alltag der Nachkriegszeit kämpft sie um ihren Traum, Künstlerin zu werden.
Monika Heintze beschreibt die innere Welt des heranwachsenden Kindes mit einer literarischen Präzision und Authentizität, die von pädagogischer Kenntnis und großer Einfühlsamkeit zeugt.
10 Fragen an Monika Heintze
Frau Heintze, mit 86 Jahren veröffentlichen Sie Ihren ersten Roman. Was hat Sie dazu bewegt, gerade jetzt zu schreiben – und warum gerade diese Geschichte?
Geschrieben habe ich immer gerne. Beispielsweise als 13/14-Jährige zu Hause heimlich und versteckt unter den Hausaufgaben. Vorzugsweise Gedichte über tragisch endende Liebesromanzen. Natürlich gereimt. Ich bin froh, dass ich sie irgendwann entsorgt habe. In der Schule Aufsätze schreiben zu dürfen, war mir das Liebste. Sie waren sehr fantasievoll. Ich musste sie öfter vor der ganzen Klasse vorlesen.
Vor ca. 6 Jahren hatte eine Freundin die Idee: Lass uns was zusammen machen, so wie früher. Sie hat eine Vierergruppe zusammengestellt, außer mir drei Frauen, die am autobiografischen Schreiben interessiert waren. Mir wurde schnell klar, dass ich meine Autobiografie nicht zum Thema machen wollte. Ich war schon als Jugendliche beeindruckt von spannenden, emotional geschriebenen Geschichten. Mich interessierte es, eine Figur zu entwickeln, die mir nahesteht und die ich literarisch behandeln könnte. Ich fand es wunderbar, mich überraschen zu lassen von meinen eigenen Einfällen.
Warum gerade diese Geschichte? Sie bot mir von vornherein eine Fülle von Grundmaterial und Anregungen aus meiner eigenen Kindheit. Warum sollte ich mir etwas ausdenken, das mit eigenem Erleben nichts zu tun hat? Ich wollte authentisch schreiben und trotzdem eine Romanfigur erfinden, die erlebt, was auch mir hätte widerfahren können.
Der Roman spielt in Ihrer Heimatstadt Berlin, am Ende des Zweiten Weltkriegs und in der Nachkriegszeit. Wie stark sind Ihre eigenen Erinnerungen in die Handlung eingeflossen?
Sie sind immer wieder eingeflossen. Jedoch: Hanna war beim Schreiben nicht ich. In parallelen Situationen geht sie völlig anders um mit dem, was in ähnlicher Weise mir begegnet ist. Und das war mir wichtig. Ich wollte eine Protagonistin, deren Grundlage vieles meiner Kindheitsgeschichte war. Aber ich wollte auch, Hanna sich immer wieder neu erfinden lassen können und staunen, wohin sie und ihre Geschichte mich führt.
Die Hauptfigur ist ein Kind, das in einer komplexen familiären Situation aufwächst. Wie viel von sich selbst finden Sie in dieser Figur wieder?
Von der Sache her schon einiges. Aber ich habe etwas völlig anderes daraus gemacht. Wie Hanna mit den Schwierigkeiten im Elternhaus umgeht, finde ich oft großartig, und ich wäre manchmal gerne so wie sie gewesen. Aber ich erzähle eben nicht meine, sondern Hannas Geschichte.
Die Beziehung zwischen Mutter und Tochter im Buch ist distanziert, manchmal auch schmerzhaft. War es schwer, darüber zu schreiben?
Nein. Aus den Stellen, wo es ein reiner Rückblick war, ist schon lange Distanz geworden.
Der Vater wird im Roman als liebevoller Gegenpol zur Mutter beschrieben. Hatten Sie selbst eine ähnliche Vaterfigur in Ihrem Leben?
Ja, durchaus. Trotzdem verhält sich der Vater von Hanna ihr gegenüber anders als mein eigener.
Künstlerische Begabung spielt im Buch eine zentrale Rolle. Wie wichtig war Kunst – sei es Schreiben, Zeichnen oder Musik – in Ihrer eigenen Kindheit und Jugend?
Zeichnen, Malen, Gedichte schreiben spielten eine wichtige Rolle in meiner Kindheit und Jugend. Vor allem das Zeichnen. Es gab in meiner Volksschulklasse eine Lehrerin, die mich auch außerhalb der Schule mit Kunstunterricht unterstützt hat. Da bin ich beim Schreiben sehr dicht an meiner eigenen Geschichte dran.
Was war für Sie die größte Herausforderung beim Schreiben dieses Romans – inhaltlich oder handwerklich?
Beides! Die verbindlichen Treffen meiner Vierer-Schreibgruppe waren mir zwar auch in terminlicher Hinsicht (alle 4 Wochen ein Text für gegenseitige Kommentare!) ein konstruktiver Druck zum Weiterschreiben, aber ich brauchte mehr Publikum und vor allem literarisch erfahrene Menschen, egal welchen Alters, die meine Texte kommentierten. Durch das Autorenforum Berlin e.V. bekam ich beim Vorlesen einzelner Texte viel konstruktive Kritik, die mir stets weiterhalf, z. B. den dramatischen Bogen noch einmal zu hinterfragen oder den Weg des Erzählstrangs noch einmal zu überdenken. Die Anregungen des Autorenforums sind bis heute immer wieder Geschenke für mich.
Wie hat sich das Schreiben dieses Buches auf Sie persönlich ausgewirkt? Gab es vielleicht auch eine Art innerer Versöhnung mit der Vergangenheit?
Die „innere Versöhnung“ liegt schon länger zurück. Das Schreiben war vor allem eine aufregende und spannende Zeit: Altes wiederzuentdecken, mit anderen Augen zu betrachten und zu erfahren, dass ich aus meinem kindlichen Ich eine Romanfigur entwickeln kann, die in einem ähnlichen Umfeld wie ich aufwächst, aber nur am Rande etwas mit mir zu tun hat. Ich habe diese Zeit als einen mich beglückenden, schöpferischen Prozess erlebt.
Was möchten Sie den heutigen Berlinerinnen und Berlinern mit Ihrem Buch über die Kriegs- und Nachkriegszeit mitgeben? Gibt es etwas, das Ihrer Meinung nach nicht vergessen werden sollte?
Oh ja! Ganz bewusst habe ich Hanna in der Ich-Form erzählen lassen. Ich möchte ihre Erlebnisse so dicht wie möglich an die Leserinnen und Leser herantragen. Hanna – selbstverständlich in ihrer Einzigartigkeit – war trotzdem eins von vielen tausenden von Kindern, die in einer von Krieg und Mangelwirtschaft geprägten Umgebung aufwachsen mussten und ihre spielerischen Ideen und Kreativität brauchten, um ihren Ängsten nicht zu erliegen. Diesen Umstand will ich mit meinem Buch ... alles muss versteckt sein sinnlich demonstrieren und festhalten.
Wie war die Reaktion Ihrer Familie oder Ihres Umfelds, als sie erfahren haben, dass Sie einen Roman veröffentlichen?
Alle, denen ich es erzählt habe, haben sich gefreut. Sie mochten die Texte, die ich ihnen auszugsweise vorgelesen habe, und meinten: Das musst du unbedingt veröffentlichen!
Planen Sie, weiterzuschreiben? Oder war dieser Roman ein einmaliges Projekt?
Oh ja, das zweite Buch, in dem Hanna, noch nicht volljährig, heimlich nach Paris ausreißt, da die Probleme mit der Mutter sie immer mehr entmündigen, ist bis auf wenige Kapitel fertig. Ich hoffe sehr auf eine Veröffentlichung.
Vielen Dank für die Beantwortung der Fragen!
...alles muss versteckt sein!
Monika Heintze ist Berlinerin. Schon als Kind begeisterte sie sich für Kunst, später unterrichtete sie Kunst an einer Sonderschule für lernbehinderte Kinder. Bis heute nimmt sie mit ihren Gemälden an Ausstellungen im In- und Ausland teil. Das Schreiben hat sie vor etwa sechs Jahren für sich entdeckt.